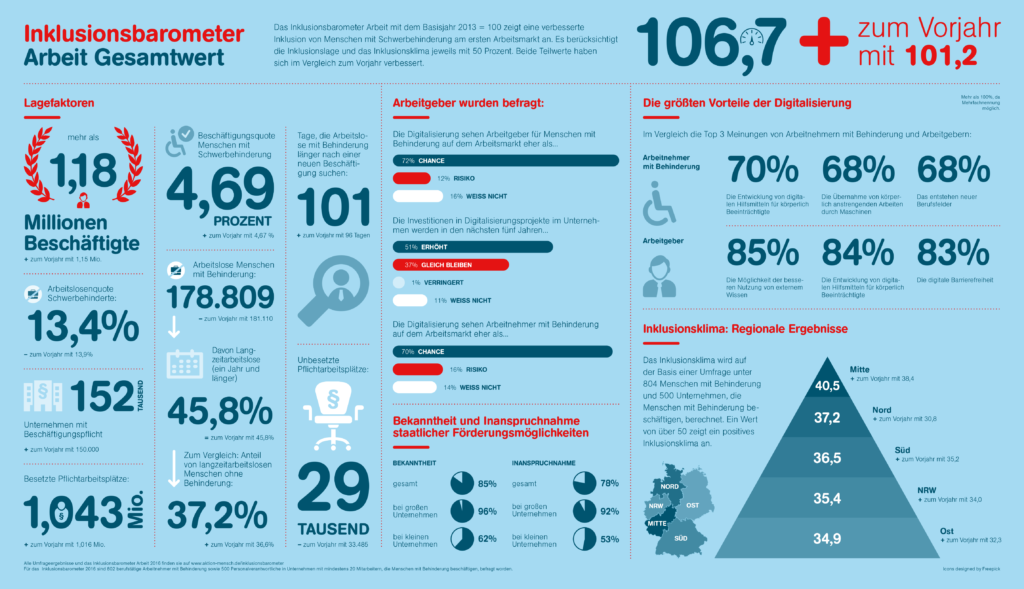Zweites Leben für Laptop und Co.
Jutta Dieckmann sitzt an ihrem Schreibtisch in der geräumigen Aufbereitungshalle der AfB an der Otto-Stadler-Straße in Paderborn. Mit einem Heißluftfön löst sie Etiketten und Aufkleber von Netzteilen und Adaptern. „Ich sortiere die Netzteile nach Hersteller und Amperezahl“, erklärt sie. Neben ihrem Tisch stehen mehrere Kisten. Sind sie voll, werden sie ins Lager gebracht oder an eine andere AfB-Filiale verschickt.
Perfekt getaktetes System
Jutta Dieckmann und ihre Kollegen arbeiten nach einem bis ins Detail organisierten und perfekt getakteten System von Abholung, Datenvernichtung, Aufbereitung, Wiedervermarktung und Entsorgung von IT- und Mobilgeräten. Die AfB gilt als Europas erstes und größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen – und befindet sich weiter auf strammem Wachstumskurs. Der Betrieb ist darauf spezialisiert, ausgemusterte IT-Geräte von Unternehmen, Versicherungen, Banken und öffentlichen Einrichtungen zu übernehmen und dabei so viele Geräte wie möglich wieder zu vermarkten.
Der vom LWL geförderte Inklusionsbetrieb bearbeitet jährlich mehr als 360.000 Geräte, die er von mehr als 1.000 Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommt. Menschen mit Behinderung wie Jutta Dieckmann stellen fast die Hälfte der gut 357 Beschäftigten, am Standort Paderborn sind es 21 von 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nachhaltiges Geschäftsmodell
Der Markt für diesen Wiederverwendungskreislauf ist größer, als man meint. „Wir arbeiten mit Konzernen wie Siemens, Provinzial und Generali zusammen, aber auch mit regionalen Firmen, Behörden und Institutionen“, sagt Monika Braun. Die AfB-Prokuristin spricht dabei stets von „Partnern“. Und denen kann die AfB durchaus etwas bieten.
„Sämtliche Datenträger werden im Rahmen eines zertifizierten Prozesses nach höchsten Sicherheitsstandards gelöscht oder geschreddert. Die Geräte werden per IT-Sicherheitstransport durch unser eigenes Personal mit unserem eigenen Fuhrpark abgeholt und zur nächstgelegenen AfB-Niederlassung transportiert“, erläutert Monika Braun. Neben der Datenvernichtung werden die Geräte erfasst, getestet, gereinigt, mit neuer Software bespielt und anschließend verkauft – mit bis zu drei Jahren Gewährleistung. Nicht mehr vermarktbare Hardware wird unter höchsten ökologischen Standards zerlegt und recycelt. Der ursprüngliche Eigentümer der Geräte erhält alle relevanten Nachweise zur Datenvernichtung.
Fujitsu-Aus als Chance
Der Leiter der Paderborner AfB-Niederlassung, Dietmar Mormann, hat alle Arbeitsschritte im Blick. Er kam 2018 vom japanischen Technologiekonzern Fujitsu, als der sein Werk in Paderborn dicht machte. „Ich hatte schon vorher AfB-Gründer Paul Cvilak kennengelernt“, sagt Mormann. „Damals haben wir noch über eine mögliche Kooperation von Fujitsu und AfB gesprochen.“ Dann kam die Schließung des Fujitsu-Standorts. Mormann begriff das als Chance, die AfB nach Paderborn zu holen. „Wir haben dann eine Ausschreibung von Fujitsu gewonnen, eine weitere von Diebold Nixdorf, und dann ging alles ganz schnell“, sagt Mormann.
Man fand mit einer 3.200 Quadratmeter großen Halle eines ehemaligen Schulbuch-Verlags eine optimale Immobilie. Der neue Niederlassungsleiter brachte gleich noch eine ganze Reihe ehemaliger Fujitsu-Kollegen mit. „Wir haben 2018 mit zwölf Leuten hier angefangen“, erzählt Mormann. Um dann personell rasch aufzustocken. „Paderborn mit seinen IT-Unternehmen hat einfach das Potenzial.“
Echter Wettbewerbsvorteil
Eine Zusammenarbeit mit der AfB ist nicht nur gut für das soziale und ökologische Gewissen, sie kann ein echter Wettbewerbsvorteil sein. „Das durch eine Partnerschaft mit der AfB gezeigte gesellschaftliche Engagement kann am Point-of-Sale unserer Partner kommuniziert und somit als Vertriebsvorteil genutzt werden“, heißt es auf einem Imageflyer des Unternehmens. Der Zusatz „social & green IT“ im Firmentitel weist darauf hin. Sozial ist die inklusive Ausrichtung der AfB, grün sind etwa Einsparungen von CO2, Rohstoffen und Energie durch die Wiederverwertung der IT-Geräte.
Die AfB-Beschäftigten in Paderborn haben seelische, körperliche und Sinnesbeeinträchtigungen. Einer von ihnen ist Martin Gasse, der die Verteilung der Hardware am Wareneingang organisiert. Dort werden die firmeneigenen Transporter entladen. „Ich sortiere und erfasse die hereinkommenden Geräte“, sagt er.

Hauseigenes Warenwirtschaftssystem
Bernd Schmelter kümmert sich um die Detailerfassung im hauseigenen Warenwirtschaftssystem. Und er schaut, ob die Datenlöschung tatsächlich vollständig erfolgt ist: „Ich bin so etwas wie die letzte Instanz.“ Thomas Müller wiederum löscht Server. Gut und gerne 20 pro Tag. Dann sortiert er sie und macht die Enderfassung für den Verkauf. Für ihn ein Traumjob: „Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten.“
Die aufbereiteten Server, PCs, Notebooks, Bildschirme, Drucker und Handys werden teilweise im Shop zum Verkauf angeboten. Zur Kundschaft zählen Privatpersonen, vor allem auch ältere Menschen, ebenso wie Steuerberater oder Zahnarztpraxen. Was sie alle am AfB-Shop schätzen, ist die ausführliche und persönliche Beratung. „Und sollte ein Käufer mit seinem Gerät daheim nicht klarkommen, dann fahren wir vorbei und helfen ihm“, sagt Niederlassungsleiter Dietmar Mormann.
Das AfB-Konzept baut auf flache Hierarchien. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter duzen sich, vom Firmengründer bis zum Praktikanten. Es gibt eine Niederlassungsleitung, eine Technische Leitung und die Teams – mehr nicht. Im Sommer wird oft gemeinsam gegrillt, der Zusammenhalt ist groß. Mehrmals im Jahr schaut auch AfB-Gründer Paul Cvilak in Paderborn vorbei. Er kennt fast alle Beschäftigten persönlich und nimmt sich Zeit für Gespräche. Seine Vision von 2004 ist längst Wirklichkeit geworden. In Paderborn und anderswo an einem der mittlerweile 23 Standorte in fünf europäischen Ländern. —