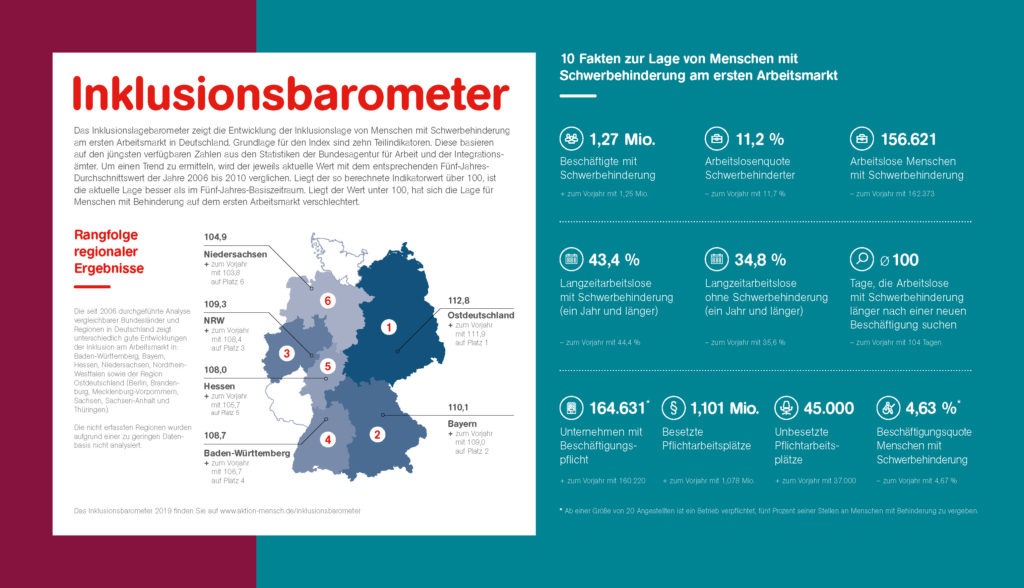Anna Spindelndreier will mit ihren Bildern Menschen erreichen, aufklären und sie zugleich berühren und glücklich machen. Mit uns hat sie über ihren Beruf, den Einstieg in die Selbstständigkeit, ihre Wünsche für die Zukunft, aber auch über die Vorurteile gesprochen, die ihr im Laufe ihrer Karriere immer wieder begegnet sind.
Frau Spindelndreier, seit wann fasziniert Sie die Fotografie?
Ich habe als Kind meinem Vater viel über die Schulter geguckt, der als Verleger arbeitet und viel fotografiert hat. Er hat früher viele Bildbände und Postkartenbücher gestaltet. Bei ihm im Büro lagen immer tausende Dias und Fotos herum. Das hat mich schon früh fasziniert. Mit neun Jahren bekam ich dann von meinem Patenonkel zur Kommunion meine erste eigene Kamera geschenkt. In dieser Zeit fing ich damit an, meine ganze Umwelt auf Zelluloid zu bannen und alles zu fotografieren, was mir vor die Linse kam.
Wie sind Sie Fotografin geworden?
Das war anfangs sehr schwierig. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich gern eine Ausbildung zur Mediengestalterin machen, war mit meinen Bewerbungen aber nicht erfolgreich. Gleichzeitig hatte ich mich als Auszubildende für Fotografie beworben, bekam bei den Vorstellungsgesprächen aber leider zu hören, dass man mich nicht anstellen könne, weil man nicht wisse, wie Kunden auf mich als kleinwüchsige Fotografin reagieren würden. Schließlich klappte es nach über 80 Bewerbungen dann doch noch. Nach dem Abschluss der Ausbildung konnte ich leider keine Festanstellung finden – ich bin nicht sicher, ob es vor allem an der schwierigen Arbeitsmarktsituation in dieser Branche lag oder doch an meinem Kleinwuchs. Eingeredet habe ich mir immer das erstere. Ich habe dann erst einmal als Assistentin in einem Fotostudio angefangen zu arbeiten. Mit der Erfahrung und den Fähigkeiten, die ich dort sammeln konnte, habe ich mich schließlich selbstständig gemacht und parallel ein Studium begonnen.
Wie war der Einstieg in die Selbstständigkeit für Sie?
Zu Beginn meiner Selbstständigkeit lag mein Fokus noch sehr auf dem Studium. Ich habe in dieser Zeit vor allem freie Fotoprojekte für die Uni gemacht und mich daneben mit studentischen Hilfsjobs über Wasser gehalten. Viel Akquise habe ich damals aber nicht betrieben. Die ersten Aufträge bekam ich dadurch, dass ich weiterempfohlen wurde, weil ich vorher schon mal anderswo gute Arbeit geleistet hatte. Was das betrifft, ist mein Einstieg in die Freiberuflichkeit also weitestgehend positiv verlaufen, sie trug sich nach und nach und ich wurde unabhängiger. Trotzdem war das rückblickend betrachtet keine einfache Phase. In der Selbstständigkeit erlebt man gerade in kreativen Branchen viele Höhen und Tiefen, erst recht am Anfang. Es braucht immer viel Disziplin. Man muss lernen, sich seine Zeit vernünftig einzuteilen, zugleich muss man mit abstrakten Arbeitsstrukturen gut umgehen können oder sich darin am besten sogar sehr wohl fühlen.
Was für Aufträge hatten Sie am Anfang und wie kamen sie zustande?
Wie gesagt waren meine ersten freien Projekte die an der Uni, zugleich bin ich, wie viele andere Fotografen auch, über die Hochzeitsfotografie an Aufträge gekommen. Das erste Vertrauen von anderen, dass ich gut in meinem Beruf bin, bekam ich also vor allem von Freunden und Freunden von Freunden.
Welchen Schwerpunkt setzen Sie in Ihrer Arbeit?
Für mich war in der Ausbildung eigentlich klar, dass ich später mal in der Still-Life-Photography Fuß würde fassen wollen, mich also auf Produktfotos spezialisieren wollte. Bei dieser Art der Fotografie fehlte mir aber schon bald die menschliche Komponente. Deshalb verlagerte ich meinen Schwerpunkt nach und nach auf die Porträtfotografie, die heute ganz klar mein Hauptbereich ist.
Sie sind als selbstständige Fotografin ja in einem Berufsfeld unterwegs, in dem die Konkurrenz groß ist. Wie heben Sie sich von den Kolleginnen und Kollegen ab?
Das ist in meinem Beruf tatsächlich gar nicht so einfach. Eine Art Markenzeichen meiner Fotografie ist wohl, dass ich Stereotypen zu durchbrechen und neue Blickwinkel zu eröffnen versuche. Bei den Motiven ziehen sich vor allem Menschen mit Behinderung wie ein roter Faden durch meine Arbeit. Am wichtigsten ist mir hierbei, dass ich mit meinem ganz persönlichen, subjektiven Blick durch die Linse schaue. Ich beschönige nichts, meine Fotos sprechen klar alles so aus, wie es ist. Ich weiß auch, dass ich das sehr gut mache und vor allem deshalb gebucht werde. Abseits davon ist aber natürlich auch meine für viele Menschen ungewöhnliche Körpergröße ein bedeutendes Merkmal – auch wenn ich immer wieder gerne betone, dass ich in erster Linie Fotografin bin und erst in zweiter Linie kleinwüchsig. Aber diese körperliche Eigenschaft spiegelt sich indirekt eben auch öfter in der Perspektive meiner Fotos wider. Man kann dabei vielleicht ein bisschen von einer „Heldenperspektive“ sprechen, also einer Sicht von unten, die ich durch meine Größe ganz automatisch einnehme. Das ist ein Blickwinkel, der besonders gerne bei Models und Politikern verwendet wird. Mit Hilfe meiner Trittleiter kann ich natürlich trotzdem auch die „normale“ Perspektive anbieten.
Wer engagiert Sie – und mit welchen Kunden arbeiten Sie am liebsten zusammen?
Aktuell arbeite ich vor allem mit vielen Selbsthilfevereinen zusammen, unter meinen Kunden sind aber auch soziale Organisationen wie Special Olympics NRW, Change.org, Aktion Mensch, die AWO oder auch mal Privatleute wie der TV-Koch Volker Westermann, der selbst kleinwüchsig ist. Lieblingskunden gibt es dabei nicht, das ist immer von den Projekten selbst abhängig, die ich machen darf. Hier begeistern mich vor allem die Aufträge, bei denen mit besonders viel Herzblut gearbeitet wird. Wenn ich abends auf meinem Rechner die Bilder sortiere und dabei in freudestrahlende Gesichter schaue, dann weiß ich genau, warum ich diesen Job mache und liebe.
Wenn Sie an Aufträge der jüngeren Vergangenheit zurückdenken: Welcher hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht und warum?
Vor einigen Wochen habe ich zusammen mit meiner sehr geschätzten Kollegin die Landesspiele der Special Olympics NRW in Neuss fotografiert. Dort haben über 1000 Athleten und Athletinnen mit Lernschwierigkeiten in unterschiedlichsten Leichtathletik-Disziplinen ihr Können gezeigt – das waren drei Tage voller Adrenalin, Action, Emotionen und Herzlichkeit, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Wie sah bei diesem Auftrag Ihr Alltag aus?
Wir standen um 8 Uhr morgens auf dem Sportplatz, um den Startschuss der Wettkämpfe mitzubekommen. Danach und für den Rest des Tages sind wir von Sportstätte zu Sportstätte gezogen und haben dabei möglichst jede Sportart festgehalten und sehr viele Sportler porträtiert. Abends gegen sieben waren wir wieder zurück im Hotel, haben die Daten gesichert, eine kleine Bildauswahl gemacht für die sozialen Medien – Marketing gehört zwischendurch auch immer mit dazu –, und die Kamera-Akkus geladen. Anschließend sind wir ziemlich erschöpft ins Bett gefallen, und am nächsten Tag ging es fit und frisch in die zweite Runde.
Sehen Sie sich privat oder beruflich manchmal mit Vorurteilen oder anderen Barrieren konfrontiert – und falls ja, wie gehen Sie damit um?
Mal abgesehen von den baulichen Barrieren, die einem im Alltag ständig begegnen – zu hohe Ladentheken, Geldscheinautomaten, Lichtschalter und so weiter – werde ich hin und wieder leider auch mit Vorurteilen konfrontiert. Am häufigsten habe ich das Gefühl, dass andere Menschen meinen, sie könnten von meiner körperlichen auf meine intellektuelle Größe schließen.
Gibt es etwas, das Sie sich in Ihrem Beruf für die Zukunft wünschen würden?
Die Fotografie ist, wie viele andere Branchen auch, ein immer noch stark von Männern dominiertes Berufsfeld. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und mehr Frauen sich trauen, in diesem Beruf selbstständig zu arbeiten. Darüber hinaus könnte die ganze Medienbranche gerne etwas lockerer und offener werden. Ich möchte nie wieder hören müssen, dass ich einen Auftrag nicht bekomme, weil man nicht weiß, wie die Kunden auf mich – also auf meinen Kleinwuchs – reagieren könnten. Der größte Erfolg wäre es aber für mich, wenn ich es so lange wie möglich schaffen könnte, mit meiner Fotografie möglichst viele unterschiedliche Leute zu erreichen, aufzuklären und glücklich zu machen. –