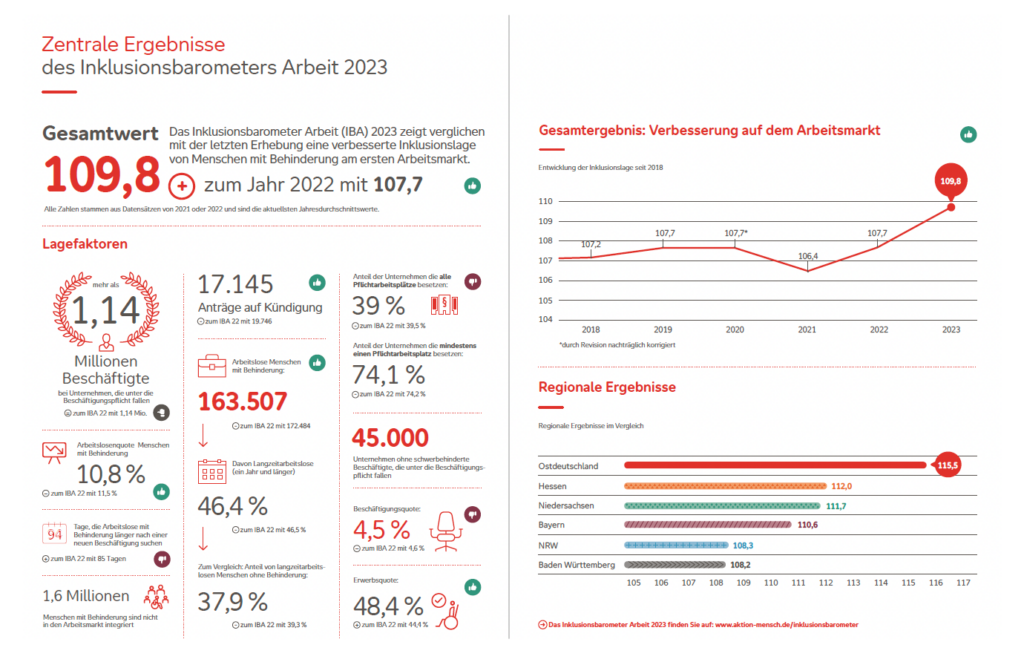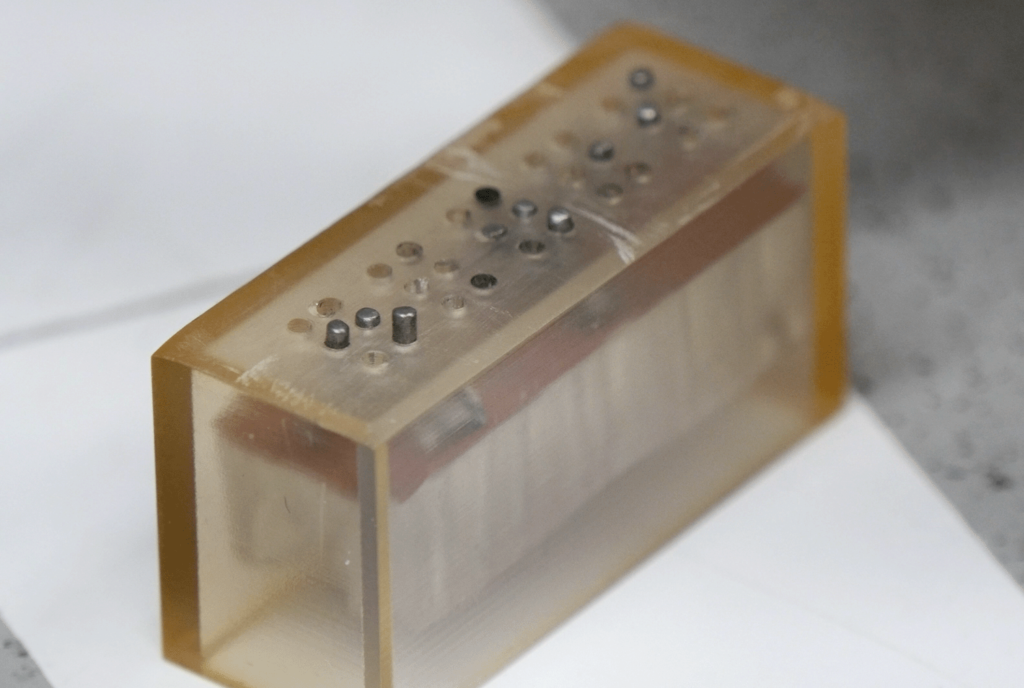Tipps für Arbeitgeber:innen, Teil 4: Was für eine inklusive Unternehmenskultur wichtig ist
#1: Frau Kurtenacker, was macht aus Ihrer Sicht eine gute inklusive Unternehmenskultur aus?
Vieles steht und fällt mit dem Verhalten der Führungskräfte. Sie sollten vertrauensvoll und wertschätzend mit allen Mitarbeiter:innen umgehen – unabhängig von einer Behinderung oder chronischen Erkrankung. Und natürlich auch unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder dem Alter. Alle Mitarbeiter:innen sollten die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Talente zu entfalten und sich weiterzuentwickeln. Führungskräfte sollten ihre Entscheidungen transparent machen und nachvollziehbar erklären. Umgekehrt müssen auch Mitarbeiter:innen offen mit ihren Vorgesetzten sprechen können. Wenn die Verantwortlichen im Unternehmen all das bedenken, haben sie schon eine Menge erreicht.
#2: In welchen Schritten können Unternehmen diesen Ansatz praktisch umsetzen?
Es ist wichtig, dass sich Führungskräfte für das Thema öffnen und bereit sind, sich zu informieren. Viele Arbeitgeber:innen sind zum Beispiel unsicher, wenn sie sich mit einer Behinderung oder Erkrankung nicht auskennen und auch nicht wissen, welche Förderprogramme und -maßnahmen es gibt. Sie sollten sich dann erkundigen, welche Hilfsmittel für Arbeitsplätze in ihrer Firma in Frage kommen, und mit Bewerber:innen offen darüber sprechen, was sie brauchen. Oft bewirken bereits kleine Änderungen in den Arbeitsabläufen sehr viel, etwa wenn Mitarbeiter:innen ihre Pausen flexibler gestalten können. Manchmal kann die Lösung auch sein, dass eine Person mit ihrem Arbeitsplatz innerhalb des Firmengebäudes umzieht, um ihn leichter erreichen zu können.
Wenn Arbeitgeber:innen finanzielle Unterstützung beantragen möchten, beispielsweise um einen Arbeitsplatz behinderungsgerecht zu gestalten oder technische Arbeitshilfen anzuschaffen, können sie sich kostenlos bei den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber:innen (EAA) beraten lassen. Die EAA helfen auch direkt bei den nötigen Anträgen weiter.
Alle geplanten Maßnahmen können Unternehmen außerdem in einer sogenannten Inklusionsvereinbarung festhalten. Die Führungsetage und der Betriebsrat oder die Schwerbehindertenvertretung schreiben darin unter anderem auf, wie viele Menschen mit Behinderung mindestens im Betrieb arbeiten und wie sie gefördert werden sollen. Manche Betriebe gründen außerdem ein Inklusionsteam, das innerhalb des Unternehmens beobachtet, bewertet und kommuniziert, ob die Ziele aus dieser Vereinbarung erreicht wurden.
#3: Wie können Führungskräfte nach außen signalisieren, dass ihr Unternehmen inklusiv arbeitet – zum Beispiel, um neue Mitarbeiter:innen mit Behinderung zu gewinnen?
Das beginnt ganz praktisch bei der Barrierefreiheit, die die Verantwortlichen bei Um- oder Neubauten, aber auch digital bei ihrem Internetauftritt mitdenken sollten. In Stellenanzeigen können Arbeitgeber:innen ihre Unternehmenskultur beschreiben und, wenn vorhanden, auf ihre Inklusionsvereinbarung und ihr Inklusionsteam hinweisen. Unternehmen, die Nachwuchskräfte ausbilden, können so gezielt junge Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ansprechen.
Und noch ein Tipp für die Jobanzeigen: Es ist besser, nicht nach „Alleskönner:innen“ zu suchen, sondern passgenau zu formulieren, welche Fähigkeiten für die jeweiligen Aufgaben wirklich gebraucht werden. Zu lange Listen mit Kompetenzen, die nicht wirklich nötig sind, schrecken möglicherweise Bewerber:innen ab oder schließen manche sogar von vornherein aus.
#4: Seit der Pandemie arbeiten viel mehr Menschen im Homeoffice. Welche Vor- und Nachteile hat das für die Zusammenarbeit in inklusiven Teams?
Mit dieser Frage haben sich zwei meiner Kolleginnen beim IW Köln in einer Studie ausführlich beschäftigt. Die Untersuchung hat zum einen gezeigt: Viele Menschen mit Behinderung können nur im Homeoffice überhaupt arbeiten, weil sie so beispielsweise ihre Pausen flexibler einteilen können oder schlicht nicht jeden Tag zum Unternehmen fahren müssen. Damit die Arbeit zu Hause gut funktioniert, brauchen sowieso alle Beschäftigten unabhängig von einer Behinderung das gleiche: einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz und Vorgesetzte, die sie gut führen und dafür sorgen, dass alle wichtigen Informationen bei ihnen ankommen.
Neben vielen Vorteilen kann das Homeoffice aber auch zum Problem werden: Laut der Studie empfinden es viele Befragte als belastend, bei der Arbeit oft oder sogar ständig allein zu sein. Führungskräfte sollten das im Blick haben und Mitarbeiter:innen bei Bedarf andere Lösungen anbieten. Wenn der Weg in die Firma weit ist, kommt vielleicht ein sogenannter „Dritter Ort“ als mobiler Arbeitsplatz in Frage. Damit ist gemeint, dass sich die Mitarbeiter:innen anstatt zu Hause oder im Unternehmen in anderen Räumen aufhalten, die näher am Wohnort liegen, zum Beispiel in Bibliotheken oder Gemeindezentren. Dort können sie arbeiten und sich mit anderen Menschen treffen, sind also nicht so isoliert wie zu Hause. Gerade für inklusive Teams ist so etwas eine gute Möglichkeit, die Zufriedenheit und Gesundheit aller Mitglieder zu erhalten und zu stärken.