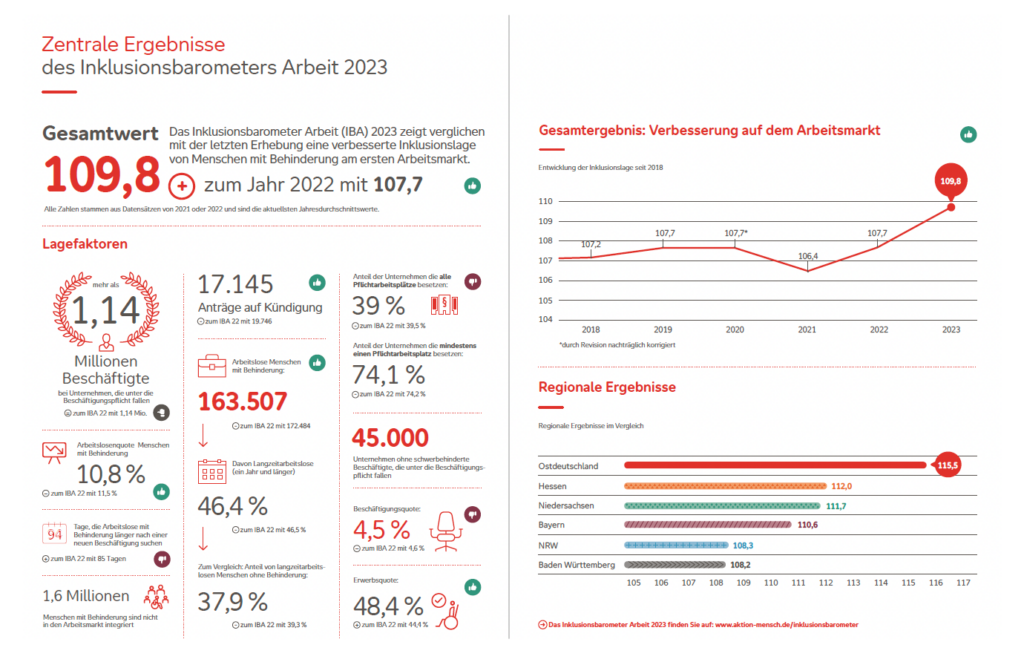Frau Peschek, warum hat Ihr Verein die InklusionsGuides ins Leben gerufen?
Wir wollen damit die Arbeitswelt inklusiver gestalten. Divers aufgestellte Unternehmen und Institutionen sind anpassungsfähiger in Veränderungsprozessen und Krisenzeiten. Vielfalt ist also ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und davon profitieren sowohl Arbeitnehmer:innen als auch Unternehmen und Organisationen. Damit dieser Wandel sozusagen von innen heraus angestoßen wird, unterstützen wir Firmen und Institutionen dabei, Menschen mit Behinderung als Mitarbeiter:innen zu gewinnen und sich als Arbeitgeber:in dabei von vornherein so aufzustellen, dass diese Zielgruppe aufmerksam auf sie wird. Um es also mit den englischen Fachbegriffen auszudrücken: Wir setzen in den Bereichen Recruiting und Employer Branding an.
Wie funktioniert das Projekt und warum setzt es besonders auf Frauen?
Frauen mit Behinderung sind auf dem Arbeitsmarkt nachweislich doppelt benachteiligt. Deshalb suchen und finden wir für unser Projekt ganz bewusst Studentinnen mit Behinderung. Sie gehen als Wegweiserinnen in Unternehmen und bieten dort ihre Expertise an, die sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen haben. Die Guides unterstützen die Firmen über ein Jahr hinweg dabei, Stellenausschreibungen inklusiv zu formulieren, Bewerbungsprozesse kritisch zu überprüfen und zu verbessern oder Arbeitszeitmodelle flexibel auszugestalten. Sie sensibilisieren aber auch die Mitarbeiter:innen des Unternehmens und vermitteln ihnen, welche Belange Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen haben oder haben können. Gerade das kann grundlegende Veränderungen bewirken – und das tritt auch oft ein. In den teilnehmenden Unternehmen beobachten wir bereits einen Kulturwandel hin zu einer inklusiven Arbeitskultur. Die Arbeitszeitmodelle werden zum Beispiel flexibler und auch die Kommunikation in Stellenausschreibungen ist anders als vorher.
Studentinnen haben ja normalerweise noch keine oder kaum Berufserfahrung. Warum sind sie trotzdem gut darin, Unternehmen zu beraten?
Die Studentinnen von heute sind ja die Arbeitnehmerinnen von morgen. Sie wissen deshalb am besten, wie sie arbeiten wollen und können, welche Bedürfnisse sie haben und welche Veränderungen in Unternehmen dafür nötig sind. Sie sind also bereits Expertinnen in eigener Sache. Der Hildegardis-Verein begleitet und qualifiziert sie außerdem durch Trainings zu verschiedenen Aufgabenbereichen. Dazu gehören zum Beispiel Workshops zu Themen wie „Wie kommuniziere ich meine eigene Behinderung?“, „Was sind Diskriminierungsformen und wie gehe ich damit um?“, „Was sind meine Stärken und wie kann ich diese gezielt in meine Arbeit einbringen?“ oder „Kommunikation und Methoden“. Und natürlich begleiten wir den gesamten Prozess eng mit.
Wie ist die Beratung eines Unternehmens oder einer Organisation organisiert?
Es gibt zwei so genannte Guidance-Phasen, die jeweils ein Jahr dauern. Für diese Zeit gehen jeweils zwei Studentinnen oder Absolventinnen mit Behinderung in eine Firma oder eine Institution. Die Verantwortlichen aus dem Unternehmen treffen sich einmal im Monat vor Ort oder manchmal auch digital mit den Guides. Dabei bearbeiten sie verschiedene Themen, zum Beispiel Stellenausschreibungen, Bewerbungsprozesse, Text- und Bildsprache, flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch bauliche Barrierefreiheit. Und natürlich ist auch die Sensibilisierung der anderen Mitarbeitenden sehr wichtig. Andere Tandems treffen sich nur alle zwei Monate, dann aber gleich für zwei volle Tage. Alle Guides durchlaufen verschiedene Abteilungen, um sich die Arbeit vor Ort genau anzuschauen und so zum Beispiel Barrieren ausfindig zu machen. Dabei bringen sie ihre eigenen Erfahrungen direkt ein. Innerhalb eines Guidance-Jahres gibt es darüber hinaus insgesamt vier so genannte Resonanzgruppentreffen. Dabei kommen alle Unternehmensbeteiligten, die Guides sowie Fachleute aus den Bereichen Inklusion und Arbeitswelt zusammen. Sie berichten bei den Treffen über Ergebnisse und Erfahrungen, tauschen sich aus, beraten sich gegenseitig, durchlaufen gemeinsam weitere Trainings und vernetzen sich untereinander.
Ist dieser umfangreiche Service für die Unternehmen kostenpflichtig?
Ja, normalerweise fällt für ein Jahr Beratung ein Teilnahmebeitrag von 5.000 Euro pro Unternehmen oder Institution an. Aber dadurch, dass wir von der Aktion Mensch und der BNP Paribas Stiftung gefördert werden, können wir auch Institutionen und Unternehmen teilnehmen lassen, die sich diesen Beitrag nicht leisten können. Sie zahlen dann nur so viel, wie sie können.
Werden die Studentinnen für ihre Arbeit entlohnt?
Ja, sie bekommen eine Ehrenamtspauschale für ihre Arbeit als Guides, also eine Aufwandsentschädigung. Außerdem erhalten sie am Ende des Prozesses ein Zertifikat über die Teilnahme am Projekt.
Wie wählen Sie die Studentinnen für Ihr Projekt aus – und wie teilen sie die Guides einem passenden Unternehmen zu?
Wir suchen und finden die Studentinnen unter anderem über Kontakte und Verknüpfungen des Hildegardis-Vereins. Den Verein gibt es ja schon seit 1907, seit 2008 führen wir Inklusionsprojekte durch. Wir haben also über viele Jahre hinweg ein großes Netzwerk sehr unterschiedlicher Frauen aufgebaut, auf das wir für das Projekt zurückgreifen können. Für die Bewerbung verschicken wir Ausschreibungsunterlagen an viele verschiedene Interessierte. Wir schreiben auch die Inklusions- und Diversitätsbeauftragten aller Hochschulen in Deutschland an, damit sie die Ausschreibung an Studentinnen weiterleiten. Natürlich nutzen wir ebenso Online-Kanäle wie LinkedIn oder unsere Website. Um teilnehmen zu können, füllen die Bewerberinnen einen Fragebogen aus, mit dem sie ihre eigenen Bedarfe, ihre Motivation, mitzumachen, und ihren Werdegang erklären. Anhand dieser und weiterer Kriterien werden sie später mit einem passenden Unternehmen „gematcht“, also zusammengebracht. Die Entfernung zum Sitz der Firma oder Organisation spielt dabei zum Beispiel eine Rolle, die Barrierefreiheit des Ortes, aber auch die jeweiligen Bedarfe der einzelnen Guides.
Wie sieht es auf der Seite der Unternehmen aus: Wie und wo gewinnen sie diese dafür, sich beraten zu lassen?
Die Unternehmen werden meistens online aufmerksam auf unser Projekt, also über LinkedIn, andere soziale Medien oder unsere Website. Einige Kontakte kommen aber auch durch persönliche Ansprache zustande. Viele Unternehmen wollen sich ja ohnehin auf den Weg machen in eine diversere Arbeitswelt, wissen aber oft nicht genau, wie. Da kommt unser Projekt meist gerade passend.
Der Bedarf und das Interesse sind also auf beiden Seiten vorhanden?
Ja, der Rücklauf für das Projekt ist großartig. Das hängt sicher auch mit den Anreizen für beide Seiten zusammen. Die Studentinnen machen wertvolle Erfahrungen und bekommen unter anderem einen direkten Einblick in die Strukturen der Unternehmen und Institutionen, die sie beraten. Sie können so fast nebenbei Kontakte knüpfen, die ihnen später helfen können, einen geeigneten Job zu finden. Die Unternehmen profitieren vom Erfahrungswissen der Guides, können sich inklusiv für die Zukunft aufstellen und etwa dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das große Interesse bestärkt uns darin, das Projekt auch nach dem Ende der Laufzeit weiterzuführen. Bisher gab es zwei so genannte Guidance-Phasen, die jeweils ein Jahr dauern, eine davon ist bereits abgeschlossen. Dabei konnten wir zehn Unternehmen und Institutionen mit jeweils zwei bis drei Guides zusammenbringen. Insgesamt sind 22 Wegweiserinnen mit dabei.
Um das zu ändern, hat der Hildegardis-Verein aus Bonn das Projekt „InklusionsGuides“ ins Leben gerufen, bei dem Studentinnen mit Behinderung in Unternehmen gehen, um diese zum Thema Inklusion zu beraten. Das Projekt läuft von Januar 2022 bis Dezember 2024 und wird von der Aktion Mensch, der BNP Paribas Stiftung und dem Hildegardis-Verein selbst mit insgesamt 350.000 Euro gefördert. Bisher konnten so bereits 22 Frauen mit Behinderung mit zehn Unternehmen und Institutionen zusammengebracht werden.