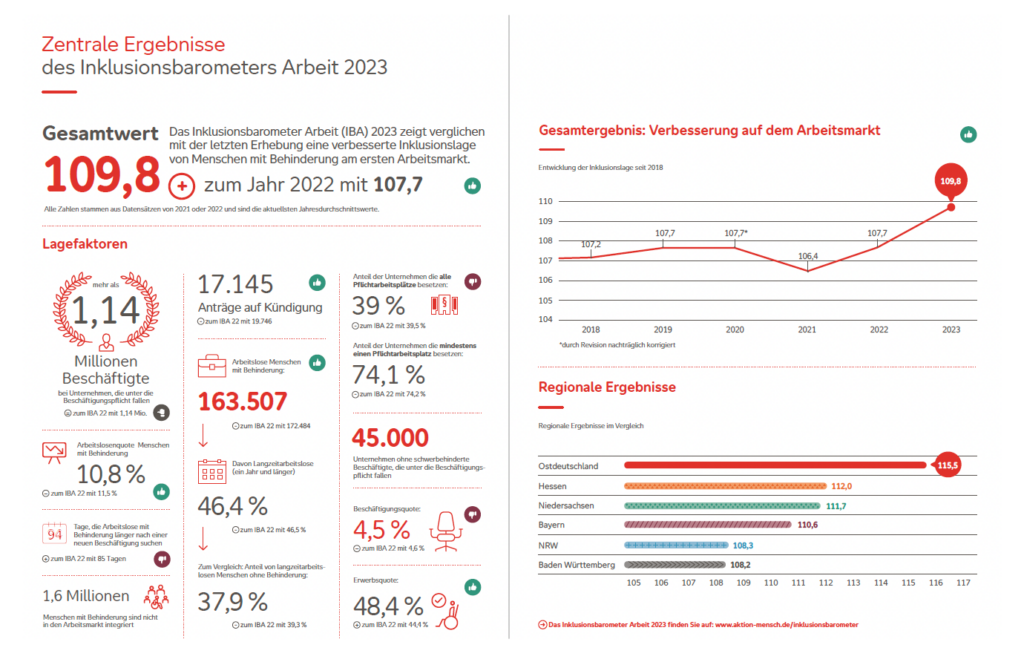Herr Jüdes, Sie und Ihr Team unterstützen Akademiker:innen mit Schwerbehinderung bei der Jobsuche. Wie stehen zurzeit deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
In vielen Unternehmen fehlen Fach- und auch Führungskräfte. Unser Team bekommt Anfragen und Stellenausschreibungen von Unternehmen zugesandt. In manchen Berufen sind es mehr Stellen als passende Bewerber:innen, die wir betreuen und vermitteln könnten. Die Chancen stehen insgesamt also recht gut. Wie in allen Gruppen wird es allerdings auch für Arbeitssuchende mit Uni-Abschluss schwieriger, je älter sie sind.
Wie helfen Sie Arbeitssuchenden dabei, eine neue Stelle zu finden?
Wir beginnen mit einem klassischen Erstgespräch: Welchen Studienabschluss hat die Person? Hat sie auch promoviert? Welche weiteren Qualifikationen bringt sie mit, was waren bisher ihre Schwerpunkte? Wir möchten zusammen mit den Arbeitssuchenden einschätzen, welches Arbeitsfeld passen könnte und welche beruflichen Ziele sie jeweils verfolgen. Wichtig ist auch, ob jemand in eine andere Stadt umziehen kann und wie weit diese weg sein darf. Wir versuchen außerdem gemeinsam herauszufinden, welche Auswirkungen eine Behinderung auf die gewünschte Tätigkeit hat, ob es also im Interesse der arbeitssuchenden Person wäre, den Arbeitgeber darüber zu informieren und früh über mögliche Hilfsmittel zu sprechen. Wenn all das geklärt ist, suchen wir gemeinsam nach passenden Stellenangeboten und geben Tipps für die Bewerbung. Manche Arbeitssuchenden machen sich Sorgen, ob sie im Bewerbungsverfahren bestehen können, weil sie zum Beispiel wegen einer Erkrankung lange aussetzen mussten oder sich aus anderen Gründen länger nicht mehr auf Stellen beworben haben. Deshalb bieten wir ihnen bei Bedarf ein fünftägiges Coaching an.
Was passiert in diesem Coaching?
Wir üben mit den Arbeitssuchenden intensiv, sich in Vorstellungsgesprächen zu gut präsentieren. Neben diesem klassischen Bewerbungstraining laden wir außerdem Entscheider:innen aus der Wirtschaft ein. Sie erzählen, worauf sie in Bewerbungsgesprächen achten. Mit diesem Wissen können die Bewerber:innen sich später besser vermarkten. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil bei vielen Verantwortlichen in Unternehmen leider immer noch Vorurteile und Bedenken gegenüber Akademiker:innen mit Schwerbehinderung vorhanden sind.
Umgekehrt wenden sich aber ja auch Arbeitgeber:innen an Sie, die gezielt Menschen mit Behinderung einstellen möchten. Wie können Sie sie unterstützen?
Für Unternehmen ist erst einmal die Arbeitsagentur vor Ort zuständig. Wir kommen immer dann zusätzlich ins Spiel, wenn für eine Stelle eine Person mit akademischem Abschluss gesucht wird. In diesem Fall veröffentlichen wir die Stellenanzeige oder -ausschreibung und beraten die Verantwortlichen bei Bedarf dabei, wie sie diese Anzeige formulieren sollten. Meistens haben wir zwischen 600 und 800 offene Stellen in unserem Portal. Wir prüfen bei jeder Anzeige, ob wir direkt jemanden vermitteln können und welche finanzielle Förderung in Frage kommt. Alle Stelleninformationen verschicken wir außerdem anonymisiert über einen sehr großen E-Mail-Verteiler. Mit diesem Newsletter erreichen wir auch ehemalige Bewerber:innen, die inzwischen schon einen Job gefunden haben, sich aber vielleicht beruflich noch einmal verändern möchten. Umgekehrt bekommen Unternehmen über einen ähnlichen Newsletter anonymisierte Profile der Bewerber:innen, aus denen nur die Qualifikationen und der Wohnort hervorgehen. Auf diese Weise können wir schon etliche Stellen vermitteln. Manchmal müssen wir aber auch mehr beraten und erst einmal falsche Erwartungen auflösen.
Welche falschen Erwartungen gibt es zum Beispiel?
Meistens geht es darum, dass Unternehmen das Stellenprofil sehr eng gefasst haben. Wir weisen sie dann auf mögliche Alternativen hin. Für Bürotätigkeiten, Stellen in der Verwaltung oder auch Führungsaufgaben suchen Firmen zum Beispiel häufig nach Verwaltungswissenschaftler:innen oder Menschen mit einem BWL- oder VWL-Abschluss. Lehrer:innen oder Menschen, die im Journalismus gearbeitet oder Sprachwissenschaften studiert haben, kommen dafür aber durchaus auch in Frage. Auch im wissenschaftlichen Bereich sollten sowohl Arbeitgeber:innen als auch Arbeitssuchende inhaltlich verwandte Studiengänge in Betracht ziehen. Wir möchten beide Seiten dazu ermutigen, ihren Blick etwas zu weiten und dadurch für alle die Chancen zu erhöhen.
In welche Branchen und Unternehmen vermitteln Sie besonders häufig neue Mitarbeiter:innen mit Schwerbehinderung auf einen Arbeitsplatz?
Das ist sehr breit gefächert. Wir bekommen zum Beispiel Stellenanzeigen von großen Unternehmen, Bundesministerien und anderen öffentlichen Arbeitgebern, Vereinen und Bundesverbänden, die Bewerber:innen für klassische Bürojobs suchen. Im wissenschaftlichen Bereich gehören Unis, das Robert-Koch-Institut, Fraunhofer-Institute und ähnliche Einrichtungen zu unserem Netzwerk. Viele Unternehmen suchen Ingenieure und IT-Spezialist:innen – insbesondere in der IT können wir die große Nachfrage gar nicht bedienen. Auch Menschen, die Rechtswissenschaften, Betriebs- oder Volkswirtschaft studiert haben, sind gefragt.