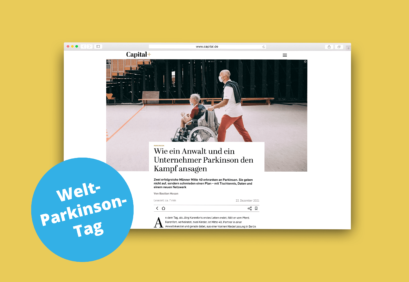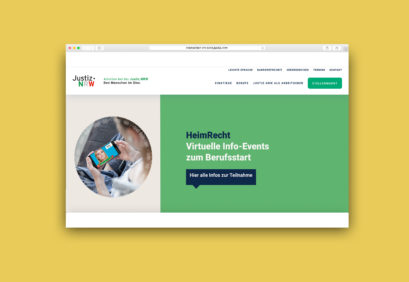Frau Jordan, das PROMI-Projekt unterstützt Menschen wie Sie, die mit einer Schwerbehinderung leben, bei der Promotion. Wie sind Sie auf die Initiative aufmerksam geworden?
Ich habe einen Aushang im Flur des Instituts gesehen und eine Professorin darauf angesprochen. Für mich passten Zeitpunkt und Aufgabenbereich optimal zusammen. Es war schon immer ein Traum von mir, selbst an der Uni zu unterrichten und zu forschen.
Hätten Sie auch ohne PROMI promoviert?
Höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe durch einen Zeckenbiss eine Borreliose bekommen, das hat damals zu einer inkompletten Querschnittlähmung geführt. Seither lebe ich mit Rollstuhl. Bis zum damaligen Zeitpunkt hatte ich im Uni-Umfeld noch nie eine Dozentin oder einen Dozenten mit einer Behinderung gesehen. Deshalb hätte mir das selbst auch erst einmal nicht zugetraut.
Warum haben Sie gezweifelt, dass Sie mit einer Behinderung eine Karriere als Forscherin einschlagen können?
Weil in den Köpfen vieler Menschen immer noch sehr viele Vorurteile vorhanden sind. Es geht nicht einfach an einem vorüber, wenn man plötzlich selbst in diese „Schublade“ fällt – und dadurch zweifelt man schneller. Heute kenne ich mehrere „rollende“ Professorinnen und Professoren, die sind für mich wichtige Vorbilder. Die Qualität, die sie in der Forschung und der Lehre bringen, ist durch ihre (Geh-)Behinderung nicht eingeschränkt. Wieso sollte das auch so sein? Es macht keinen Unterschied, ob lehrende oder forschende Menschen eine Seh- oder Hörbehinderung, eine chronische Erkrankung oder eben eine andere körperliche Behinderung haben. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und die Antidiskriminierungsgesetze in Deutschland haben in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass Universitäten in der Regel gut mit dem Rollstuhl befahrbar sind. Dadurch hat sich für Menschen wie mich, die rollend unterwegs sind, vieles verbessert und vereinfacht.
Wie kam es dazu, dass Sie sich für das PROMI-Projekt beworben haben?
Als ich vor zehn Jahren plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen war, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich hatte damals gerade mein Diplom-Studium in Sozialarbeit und -pädagogik erfolgreich abgeschlossen. Wenige Monate später bekam ich einen neuen Borreliose-Schub. Danach spürte ich meine Beine nicht mehr. Fast alle Stellenanzeigen für Berufsanfänger setzten damals aber „Mobilität“ voraus, viele waren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ausgeschrieben. Eine Sozialarbeiterin, die nicht stehen oder umherlaufen kann – das schien kaum denkbar. So bin ich mit ausgezeichnetem Diplom erst einmal in Hartz IV gelandet.
Heute kenne ich mehrere „rollende“ Professorinnen und Professoren, die sind für mich wichtige Vorbilder. Die Qualität, die sie in der Forschung und der Lehre bringen, ist durch ihre (Geh-)Behinderung nicht eingeschränkt. Wieso sollte das auch so sein?
Micah Jordan
Ich musste damals also gleich mit mehreren Herausforderungen zurechtkommen. Während der Zeit, in der ich vieles neu lernen und an meine Behinderung anpassen musste, habe ich ein Masterstudium angefangen und „Soziale Arbeit und Lebenslauf“ studiert. Ich habe damals nebenher in der wissenschaftlichen Begleitforschung gearbeitet und bin dort auf eine pädagogische Methode gestoßen, die mich sofort begeistert hat: Das Peer Counseling. Der Ansatz dieses Konzeptes ist die professionelle Beratung von und für Menschen mit Behinderung. Ich habe mich daher studienbegleitend zur Peer-Beraterin ausbilden lassen. Anschließend eröffnete mir das PROMI-Projekt die ganz neue Möglichkeit, direkt eine Promotion anzuschließen und damit eine akademische Karriere einzuschlagen. Das hätte ich ohne dieses Förderprogramm wahrscheinlich nicht gemacht.
Wie sieht Ihr Alltag als Promovierende und wissenschaftliche Mitarbeiterin aus?
Der ist oft relativ unspektakulär: Ich unterrichte, korrigiere und bewerte Hausarbeiten, schreibe Gutachten zu Bachelor- und Masterarbeiten oder gestalte auch mal spontan eine Seminareinheit, wenn sich Studierende kurz vorher krankgemeldet haben, die eigentlich ein Referat halten sollten. Höhepunkte sind es, wenn ich Studentinnen oder Studenten bei der Themenfindung und dem Schreiben ihrer Abschlussarbeiten begleiten oder wenn ich in meinen Veranstaltungen auf aktuelle sozialpolitische Entwicklungen wie die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes Bezug nehmen kann. Manchmal lade ich auch Menschen aus der Praxis der Sozialen Arbeit in meine Seminare ein. Dann entsteht oft ein lebendiger Austausch zwischen den Studierenden und den „Professionellen“ – das sind begeisternde Momente.
Welche Vorteile hat PROMI Ihnen gebracht?
Sehr viele. Zuallererst arbeite ich jetzt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in meinem Traumjob und verdiene Geld. Ich forsche zu einem Thema, bei dem es noch viel zu entdecken gibt und bei dem ich sämtliche Perspektiven selbst sehr gut kenne: als Ratsuchende, als Beraterin, als Mensch mit und ohne Behinderung. Außerdem habe ich auf Fachtagungen und Konferenzen andere Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung kennengelernt.
Auch dadurch habe ich gelernt, meine Behinderung als einen Teilaspekt meines Lebens zu sehen und nicht mehr als Hauptthema. Ich nehme zugleich nichts mehr als selbstverständlich hin. Was auch ein großer Vorteil ist: Die PROMI-Organisatorinnen und -Organisatoren bieten regelmäßig Netzwerktreffen an, bei denen sich alle Doktorandinnen und Doktoranden des Programms kennenlernen und ihre Forschungsprojekte vorstellen können. Auch hier habe ich vom informellen Austausch mit anderen Leuten in ähnlichen Situationen profitiert. Es entstanden sogar Freundschaften und Kooperationen für andere Projekte.
Gibt es auch negative Seiten?
Wie in allen Jobs, ja. Belastend ist zum Beispiel, dass die Arbeitsverhältnisse für die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befristet sind. Außerdem arbeite ich in meinem Job sehr viel – mitunter deutlich über den vertraglich bestimmten und bezahlten Stundenumfang hinaus, weil ich neben der Begleitung der Studierenden bei ihren Arbeiten und Prüfungen auch viele Verwaltungsaufgaben übernehmen muss. Trotzdem arbeite ich sehr gerne in der Lehre. Ich reise auch gern zu Tagungen und Kongressen und tausche mich mit Kolleginnen und Kollegen aus. Andersherum schätze ich auch sehr die ruhigen Momente, wenn ich zwischen Büchern an meinem Schreibtisch sitzen kann.
Was möchten Sie nach der Promotion machen?
Ich möchte gerne in der Forschung und der Wissenschaft bleiben. Ich arbeite seit zwei Jahren nebenher in der Fort- und Weiterbildung für (Peer-)Beraterinnen und -Berater. Wir diskutieren dort unter anderem, wie Seminareinheiten so gestaltet werden können, dass die Teilnehmenden neue Impulse und Denkweisen für sich mitnehmen können. Die Studierenden lernen zum Beispiel, dass es nicht „die Behinderten“ gibt und dass die Arbeit mit Menschen immer sehr vielfältig und komplex ist. Wir untersuchen außerdem gemeinsam, welche Faktoren offen oder versteckt bestimmte Denkmuster auslösen oder verstärken – und überlegen, wie wir das verändern können.
Über unsere Interviewpartnerin

Name: Micah Jordan
Geburtsjahr: 1976
Wohn-/Arbeitsort: Kassel
Werdegang und Berufe: Diplom-Sozialarbeiterin und -pädagogin, Master-Absolventin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin, Trainerin für Peer Counseling (EUTB) und Peer Counselor (LVR), Schwesternhelferin und Trauerbegleiterin
(Persönlicher Bezug zum Thema) Behinderung: Hat eine inkomplette Querschnittslähmung infolge einer neurologischen Erkrankung und ist deshalb seit 2009 Rollstuhlfahrerin.
Persönlicher Antrieb für ihren Job: Interessierte sich schon immer dafür, warum Menschen so sind, wie sie sind und ist neugierig, nachzuvollziehen, wie Brüche in der Biografie sich auf ein Leben auswirken können. Wollte lernen, mit welchen Methoden und Ansätzen Menschen zum Beispiel in Krisen gut begleitet werden können.
Berufliche Erkenntnisse und Ziele: Stellte fest, wie positiv sich Menschen mit kognitiven Behinderungen und psychischen Erkrankungen im Laufe der Jahre durch das Peer Counseling verändern: Sie werden selbstsicherer und selbstbewusster, viele wirken lebensfroher und mutiger, einige brauchen sogar erstmals seit langem keine Krisenunterbringung mehr in einer Psychiatrie.
Will in ihrer Promotion erforschen, ob und welche anderen (auch negativen) Begleiterscheinungen beim Peer Counseling sowohl für die Beratenden als auch für die Ratsuchenden auftreten können.