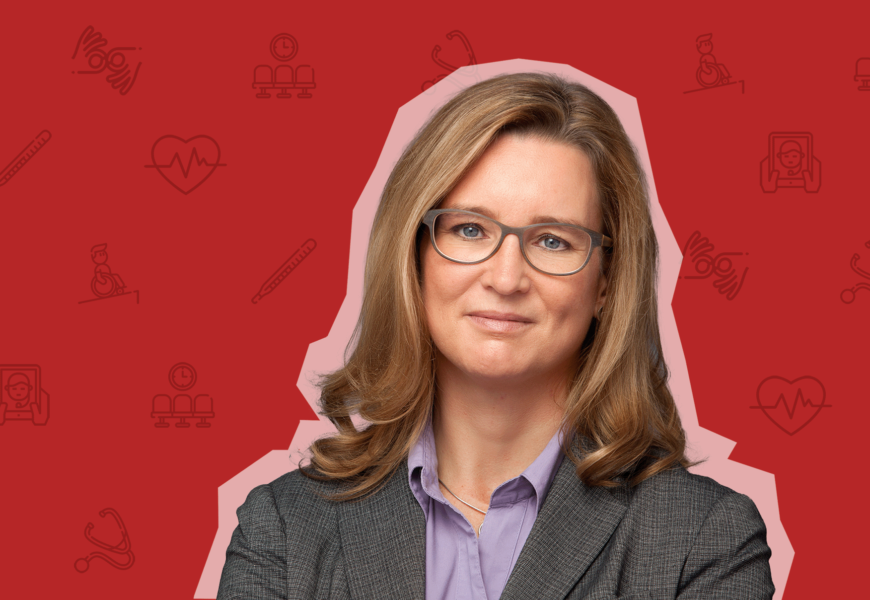Frau Sappok, warum braucht es eine eigene Medizin für Menschen mit Behinderung?
Menschen mit Behinderung werden in Deutschland oft noch nicht so gut medizinisch versorgt, wie es möglich und nötig wäre. Das liegt daran, dass sie häufig viele körperliche und auch psychische Erkrankungen haben und deswegen eine besonders hochwertige ärztliche Versorgung benötigen. Leider erschweren in unserem Gesundheitssystem aber viele Barrieren den Zugang zu einer solchen Betreuung. Und wenn sie dann in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind viele Mitarbeiter:innen überfordert. Zum Beispiel, weil sich Ärzt:innen mit bei diesen Personen häufigen Krankheitsbildern kaum oder gar nicht auskennen. Oder schlicht, weil ein Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung die übliche Eingangsfrage „Was führt Sie zu mir?“ nicht versteht oder nicht beantworten kann – der Arzt oder die Ärztin aber keinen anderen Zugang findet.
Wie wollen Sie das ändern?
In meinen Vorlesungen und Seminaren werde ich medizinisches Fachwissen vermitteln, zu Krankheitsbildern, die bei Menschen mit Behinderungen überdurchschnittlich häufig auftauchen. Um zum Beispiel bestimmte genetische Syndrome zu erkennen, müssen Mediziner:innen erst einmal damit vertraut sein. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind übrigens auch häufig im Autismusspektrum. Die Diagnose wird bei ihnen aber mit anderen oder angepassten Untersuchungsverfahren gestellt als bei Menschen ohne Lernbehinderung. Darüber hinaus möchte ich meine Studierenden auf den Umgang mit Patient:innen, die eine Behinderung haben, vorbereiten und sie für die Barrieren im Gesundheitswesen sensibilisieren.
Können Sie diese Barrieren genauer beschreiben?
Die erste große Hürde ist, überhaupt einen Arzttermin zu bekommen. Für Personen im Autismusspektrum ist es oft schon schwierig, in einer Praxis anzurufen. Hier kann helfen, wenn sie die Möglichkeit haben, online einen Termin zu buchen. Aber das ist bisher ja eher die Ausnahme. Ein weiteres Problem ist, dass Praxen und Kliniken Menschen mit Behinderung gar nicht erst als Patient:innen annehmen möchten oder rasch wieder aus der Behandlung entlassen. Deshalb suchen diese Patient:innen häufig Rettungsstellen auf, wo aber nur akute Erkrankungen untersucht und behandelt werden. Eine langfristige medizinische Versorgung ist so natürlich nicht möglich.
Warum lehnen Ärzt:innen denn Menschen mit Behinderung als Patient:innen ab?
Die Behandlung kann kompliziert und zeitintensiv sein, wenn Patient:innen bei bestimmten Untersuchungen Angst haben, etwa in der Gynäkologie oder Urologie. Manchmal wird auch gesagt, sie seien „nicht wartezimmerfähig“ oder in Kliniken „nicht führbar“.
Wie bitte?
Dahinter stecken Ängste und teilweise auch Vorurteile. Viele Ärzt:innen haben einfach kaum Erfahrung mit Menschen mit Behinderung. Sie sind verunsichert, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wie sie mit Menschen umgehen und kommunizieren sollen, die nicht sprechen können. Auch das wollen wir ändern, indem unsere Studierenden an der Klinik von Anfang an mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kommen. Wir möchten die Perspektive umkehren. Nicht die Patient:innen sollen sich anpassen, sondern Kliniken und Praxen müssen passende Rahmenbedingungen schaffen, etwa, indem medizinisches Personal die Leichte Sprache erlernt.
Der Bedarf für solche Veränderungen ist offenbar groß. Warum gibt es in Deutschland erst jetzt die erste Professur in diesem Fachgebiet?
Menschen mit Behinderung haben keine große Lobby. Und es gibt auch kein großes Interesse bei den Kostenträgern, weil eine individuelle und dadurch zeitintensivere Betreuung teurer ist. Aber eine gute Gesundheitsversorgung ist notwendig, um ein Höchstmaß an Lebensqualität und Teilhabe zu erreichen, so wie es etwa die UN-Behindertenrechtskonvention fordert. Das ist übrigens ein weltweites Problem. In Großbritannien und den Niederlanden gibt es zwar schon Lehrstühle für Behindertenmedizin und mehr Forschung als hier. Aber in den meisten europäischen Ländern oder auch in den USA, in Asien oder weniger entwickelten Ländern spielt das Themengebiet immer noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Wie sind Sie selbst zu Ihrem jetzigen Spezialgebiet gekommen?
Das war ein Zufall. Während meiner psychiatrischen Facharztausbildung am Krankenhaus Königin-Elisabeth Herzberge in Berlin wurde ich auch im Behandlungszentrum für psychische Gesundheit bei Entwicklungsstörungen eingesetzt; dort werden psychisch erkrankte Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung behandelt. Dabei habe ich Feuer gefangen. Das Fachgebiet ist spannend und anspruchsvoll, und die Arbeit mit Menschen mit Behinderung hat mir sofort viel Freude gemacht. Bei der Behandlung bin ich immer wieder auf Fragen gestoßen, auf die ich in der Fachliteratur keine Antworten finden konnte. Also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und die Fragen selbst zu beantworten. Alle meine Forschungsthemen haben sich direkt aus dem Behandlungsalltag ergeben.
Können Sie ein Beispiel erzählen?
Anfang der 2000er-Jahre kam eine junge Frau mit einer Lernbehinderung zu uns. Ihr Arzt hatte ihr ein Medikament gegen Schizophrenie verordnet, was ihr nicht geholfen hat, denn die Diagnose war falsch – und entsprechend auch das Medikament. Ihre Mutter hat uns erzählt, dass sich die Tochter schon als Kind so verhalten habe wie später als junge Erwachsene. Schizophrenien entwickeln sich aber in der Regel erst im jungen Erwachsenenalter. Ich habe viel recherchiert, was es stattdessen sein könnte, und kam schließlich auf das Thema Autismus. Damals war noch gar nicht bekannt, dass Menschen mit kognitiven Behinderungen häufig Autist:innen sind, und es gab kaum Diagnostikmöglichkeiten für diese Patient:innen. Im Rahmen meiner Habilitationsarbeit habe ich verschiedene Untersuchungsinstrumente entwickelt oder für Menschen mit Behinderungen angepasst, die auch andere Ärzt:innen anwenden können. Seitdem werden seltener Schizophrenien diagnostiziert. Für die Patient:innen ist das sehr wichtig, weil sie keine falschen Medikamente mehr bekommen, sondern ihr Umfeld stattdessen autismusfreundlich gestaltet wird.
Sie treten Anfang 2023 nicht nur Ihre Professur an, sondern werden auch Direktorin der neuen Universitätsklinik für Inklusive Medizin am Krankenhaus Mara in Bethel. Was haben Sie in dieser Klinik vor?
Wir möchten das dortige Zentrum für Behindertenmedizin erweitern. Neben der internistischen und chirurgischen Abteilung wollen wir in Zukunft auch ein psychiatrisches Behandlungsangebot schaffen. Diese drei Stationen sollen aber nicht nebeneinander arbeiten, sondern Patient:innen gemeinsam betreuen. Je nach Diagnose wird natürlich ein:e Expert:in die Fallführung übernehmen, aber Fachleute aus allen Bereichen werden in gemeinsamen Visiten interdisziplinäre Behandlungspläne entwickeln und umsetzen.
Was muss bis Ende des Jahres noch passieren, damit Sie im Januar starten können?
Die Klinik wird für das zusätzliche psychiatrische Angebot umgebaut, wir brauchen Räume und Material für die Kreativ-, Musik- und Ergotherapie, für Einzel- und Gruppengespräche. Darüber hinaus werden wir einen geschützten Bereich einrichten, in dem wir Menschen mit schweren Verhaltensstörungen betreuen werden. Für all diese Angebote suchen wir gerade natürlich auch Personal, etwa Psycholog:innen, Psychiater:innen und Kreativtherapeut:innen.
Werden Sie auch Menschen mit Behinderung im Team haben?
Ja, wir planen, sowohl in der Klinik als auch in der Lehre und Forschung in inklusiven Teams zu arbeiten.
Zum Schluss ein Ausblick: In ein paar Jahren werden Ihre ersten Student:innen ihren Abschluss haben und in den Beruf starten. Wie können diese das Wissen aus Ihren Vorlesungen einsetzen?
Ich wünsche mir, dass sie sich freuen, wenn Menschen mit Behinderung in ihre Praxis oder Klinik kommen. Dass sie Menschen mit Behinderung mit offenen Armen empfangen und diese umgekehrt nicht mehr auf die vielen Schwierigkeiten stoßen wie jetzt. Und ich würde mich freuen, wenn einige Studierende das Fachgebiet so spannend finden, dass sie darin promovieren und ein immer regeres wissenschaftliches Leben entsteht. —
Über unsere Interviewpartnerin

Name: Tanja Sappok
Geburtsjahr: 1970
Wohn- und Arbeitsort: Bielefeld
Beruf: Neurologin und Psychiaterin
(Persönlicher Bezug zum Thema) Behinderung: ist neugierig und genießt den Kontakt mit allen Patient:innen; findet dieses Arbeitsfeld extrem spannend, vielfältig und persönlich erfüllend.